Mein Vater war Bildhauer und Mitglied der GSMBA, der Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten. Ruth, die Bildhauerin, die bei meinem Vater die Lehrabschlussprüfung absolviert hatte – sie wurde mir später eine wichtige Freundin –, war lange kein Mitglied. Der Verband war Frauen verschlossen. Als er sich ihnen 1972 endlich öffnete, änderte er seinen Namen nicht; er hiess unverändert Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten. Die männlichen Endungen sollten fortan als generisches Maskulinum, als geschlechtsfrei verstanden werden. Geschlechtsneutral war die GSMBA allerdings noch lange nicht, ihre Mitglieder blieben weitgehend männlich. Als 2001 die GSMBA aufgelöst und in Visarte überführt wurde, war das viel weniger Folge einer sexuellen Diversifizierung der Mitgliedschaft, als die Reaktion darauf, dass sich die Mittel des Ausdrucks der bildenden Kunst enorm verändert und erweitert hatten.
Ruths Leistung verblüffte meinen Vater übrigens sehr. Er hatte noch nie einen ähnlich guten Lehrabschluss abnehmen können. Sie heilte ihn von der Überzeugung, Bildhauerei sei zu streng für eine Frau. Glücklicherweise hatte sich zuvor einer seiner Berufskollegen erweichen lassen, eine „Lehrtocher“ statt einen „Lehrling“ aufzunehmen.
Nun aber wieder zur GSMBA: Ich nahm die wundersame Bedeutungserweiterung der männlichen Personenbezeichnungen damals dankbar hin. Genau, wie ich gelernt hatte, es als ungeheures Privileg zu verstehen, dass ich als Mädchen das kantonale Gymnasium besuchen konnte.
Spätestens seit 1984, als ich die unübertroffen scharfen und geistreichen linguistischen Analysen von Luise F. Pusch („Das Deutsche als Männersprache“) gelesen habe, nehme ich aber die männersprachige Doppelbödigkeit nicht mehr hin. Ich bezeichne mich selbst nicht als Teilnehmer, Steuerzahler, Patient oder was auch immer. Ich bin kein Mann, und dazu stehe ich absolut, und dem generischen Maskulinum misstraue ich gründlich. Wenn andere Frauen sich mit männlichen Personenbezeichnungen bezeichnen, klirrt es furchtbar in meinen sprachsensiblen Ohren.
Die Kenntlichmachung der Erwünschtheit oder der Anwesenheit von Frauen mittels der Endung -in ist eine im Grunde allerdings äusserst zweifelhafte Lösung. Und das mehrfach:
- Das Anhängsel -in an die unmarkierte männliche Form konserviert im Sprachsystem die jahrtausendealte Abhängigkeit der Frau vom Mann und ist eine sprachliche Diskriminierung ersten Ranges, schreibt Pusch pointiert.
- Die Markierung als Frau verweist die Frauen immer und überall auf ihr Frausein, auch dann, wenn das Geschlecht gerade keine Rolle zu spielen hat. Während sich die Männer in ihrer Grundform entweder als sexuell oder aber als geschlechtsfrei verstanden wissen können. Georg Simmel, der Kulturphilosoph und Mit-Gründungsvater der Soziologie, schlussfolgerte aus dieser Beobachtung gedankenvoll: „Für den Mann ist das Geschlecht ein Tun, für die Frau ein Sein“. An anderer Stelle sinniert er überzeugender: Im Verhältnis der Geschlechter situiere sich das Männliche einerseits relativ zum Weiblichen, andererseits sei es ihm gleichzeitig gelungen, sich zum Absoluten aufzuschwingen. So komme es, dass die Männer sich als geschlechtslos erleben könnten, während die Frauen sich immer relativ zum Männlichen definiert sehen und also in jedem Moment auf ihre Weiblichkeit verwiesen würden. Es verhalte sich hier nicht anders als wie beim Verhältnis des Herrn zum Sklaven, wo es „zu den Privilegien des Herrn (gehört), dass er nicht daran zu denken braucht, dass er Herr ist, während die Position des Sklaven dafür sorgt, dass er seine Position nicht vergisst“.
- Wird zugunsten der Sichtbarkeit der Frauen das Splitting gewählt (Teilnehmerinnen und Teilnehmer), gelingt es zwar, der männlichen Form ihre Doppelbödigkeit wegzunehmen und ihr den generischen Anspruch abzusprechen. Nur: Die Stammform wird damit diskret den Männern überlassen. Und so kommt 1) zur Geltung.
- Das Splitting fixiert in seinem Schatten die zweigeschlechtliche Ordnung der Welt und schliesst offensiver denn je alle nicht-binären Menschen aus.
- Beim Redigieren von öffentlichen Texten vermisse ich nun oft eine akzeptierte „generische“, d.h. geschlechtsneutrale Form. Zwar lässt sich die umständliche Paar-Schreibung in vielen Fällen elegant kompensieren, und das übrigens nicht selten durchaus gewinnbringend für den Text. Aber nicht immer. Zum Beispiel in einem Satz wie: „Regula Rytz war eine der am breitesten akzeptierten Parteipräsidentinnen.“ Bedient die Schreiber*in hier keck ein generisches Femininum und meint die Parteipräsidenten selbstverständlich mit? Oder wird hier Regula Rytz nur mit den ganz wenigen Frauen verglichen, die je ein Parteipräsidium innehatten? Das Binnen-I und die jetzige Sternchen-Erweiterung würden hier klare Verhältnisse schaffen: Regula Rytz war einer der am breitesten akzeptierten Parteipräsident*innen.
Auch das Gendersternchen überlässt die Grundform den Männern. Schon deswegen ist es für mich nicht die endgültig zufriedenstellende Lösung. Immerhin aber funktioniert sie als als Allquantor: Alle Repräsentant*innen einer Menge werden aufs Mal eindeutig zusammengefasst. Zudem scheint mir sehr sinnvoll, dass die Frauen und Non-Binären nun sprachlich explizit erscheinen, mindestens solange jedenfalls, bis ihnen so hohes Ansehen und Selbstverständlichkeit zukommt wie den Männern. Andererseits stresst das ständige Auflisten der geschlechtlichen Kategorien das Merkmal der Geschlechtlichkeit bedenklich. Die Fokussierung auf dieses Merkmal ist eine arge Verkürzung nicht nur des menschlichen Seins, sondern auch des Diskriminierungsspektrums.
Nachdem ich nun noch einmal die von Luise F. Pusch vor 40 Jahren geschriebenen Aufsätze gelesen habe, bin ich eigentlich erst recht überzeugt, dass die richtige Lösung die wäre, die sie damals als beste beschrieb: Für die nächsten tausend Jahre wird dem Femininum die generische Funktion zugestanden. Der gleichzeitige Vorschlag, fortan nur nach weiblich und nicht-weiblich zu unterscheiden, enthält ja eigentlich schon auf elegante Art die Lösung für die queer erweiterte Sicht auf die sprachliche Gleichberechtigung: Nicht-weiblich umfasst die Männer und alle Weiteren; es ist endlos offen für alle Menschen, die mit ihrer Identität die diskriminierende zweigeschlechtliche Ordnung sprengen.

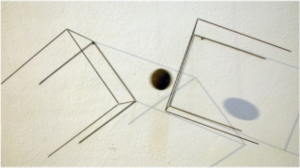
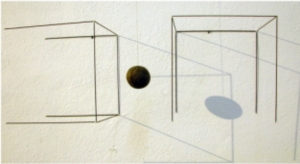
Skulptur in drei verschiedenen Positionen – von Lukas Ulmi



Schöne, umfassende Auflistung der Problematik. Aber nach dem pointierten Schluss bin ich so klug, ach, wie zuvor: Wie schreibe ich ein Femininum ohne das Anhängsel -in? Hat da Luise F. Pusch eine Lösung?
Ja, hier das Fazit von Luise F. Pusch in ihrem Aufsatz Das Deutsche als Männersprache. Diagnose und Therapievorschläge: „Ich plädiere mit aller Entschiedenheit für die Forcierung des Femininums plus -in, und das, obwohl die femininen Suffixe, wie ich gezeigt habe, hochgradig diskriminierend sind.“ Auch, weil „die Geschichte viele Fälle kennt, in denen die Termini, Kennzeichnungen u. ä., die ursprünglich diskriminierende Funktion hatten, ’neutralisiert‘ und oder gar zum Gütezeichen wurden.“
In ihrem nächsten Buch Alle Menschen werden Schwester schlägt sie als „natürliche Übergangslösung – so etwa für die nächsten zwei-, dreitausend Jährchen – eine Totale Feminisierung“ der Sprache vor. So sei das Problem schon mal politisch gelöst, eine linguistische Lösung könne dann später gefunden werden.
Luise F. Pusch erläutert das Problem in allen Facetten absolut brillant – eine ultimative (Wieder-)Leseempfehlung für diese beiden Bücher!
Danke für die große Wertschätzung meiner Beiträge zum Thema. Und danke für diesen Blog. Ich bin gespannt auf die kommenden Beiträge. Viel Spass und Erfolg damit!